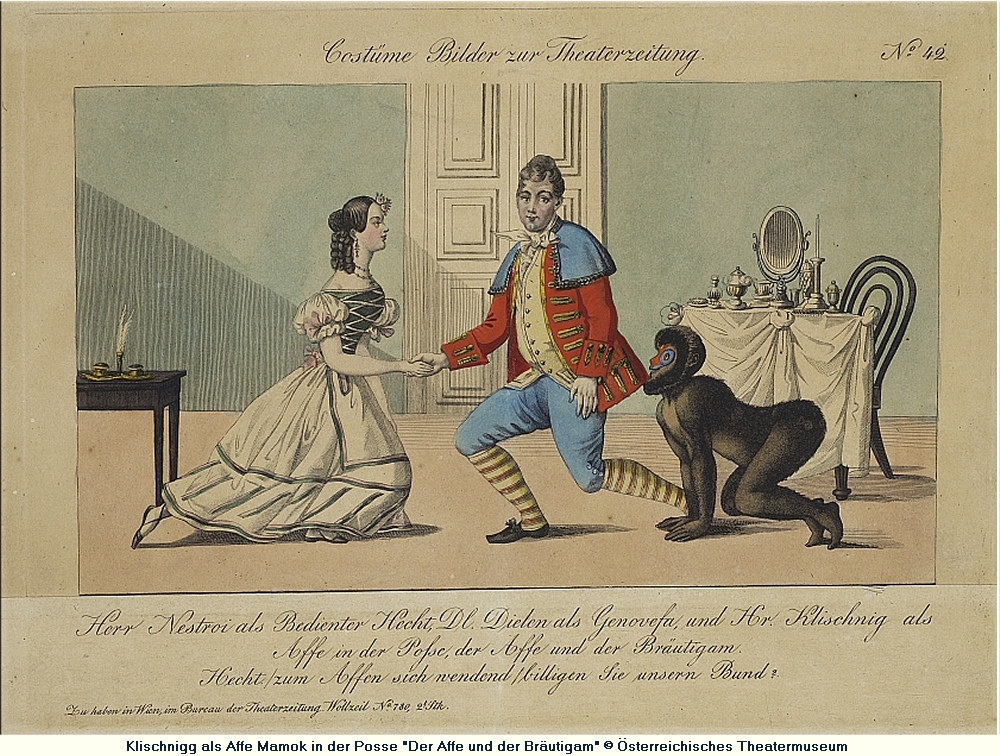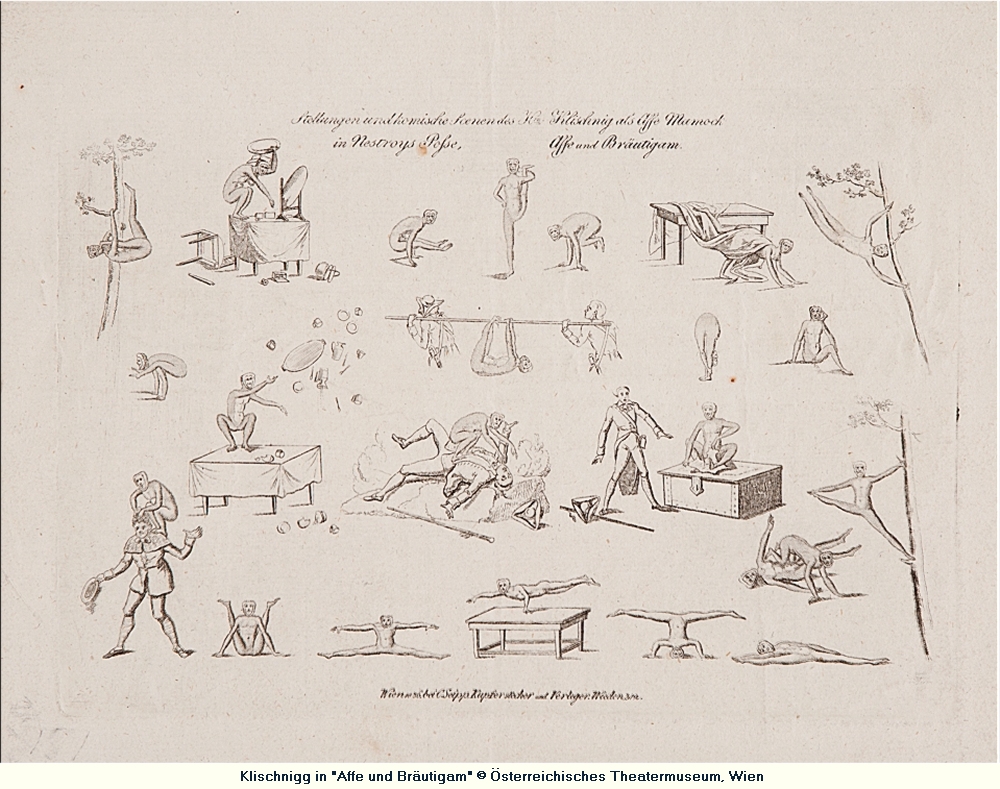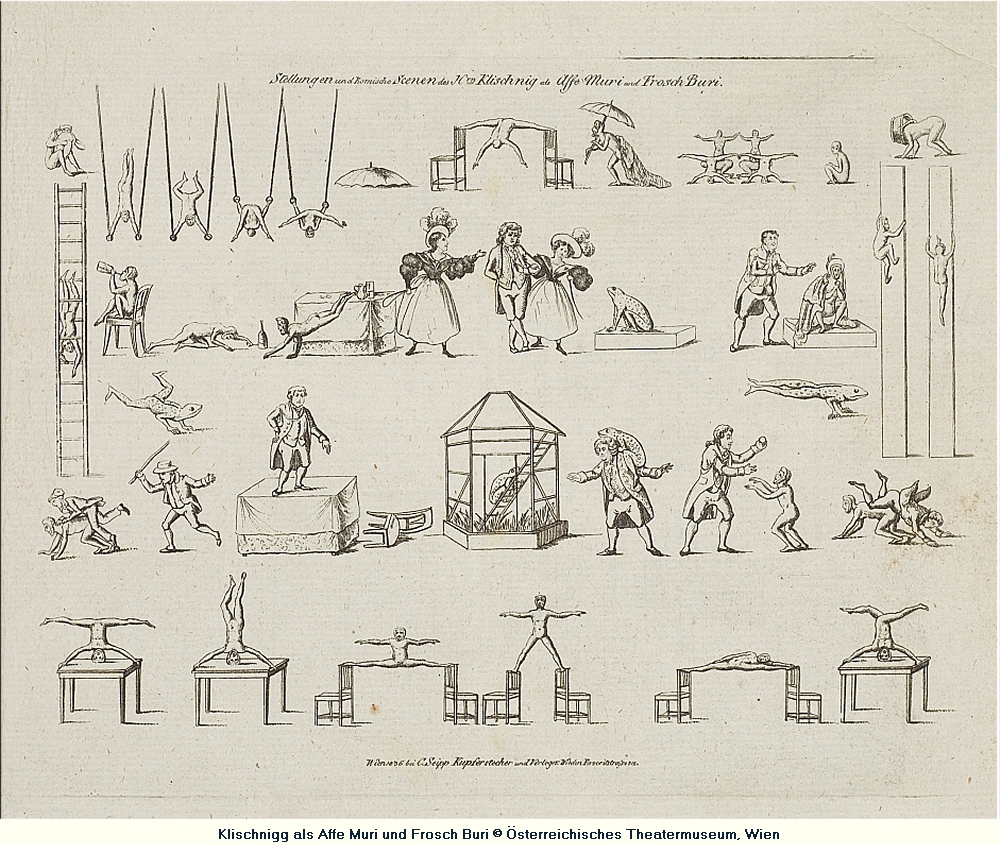Österreichisches Biographisches Lexikon
|
Biographie des Monats
|
Der populärste Tiermimiker
der Theatergeschichte: Eduard Klischnigg
 „Ist
es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein
Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von
Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und
„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren
international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib
geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein
Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er
indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.
Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des
Artisten, ungeklärt.
„Ist
es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein
Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von
Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und
„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren
international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib
geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein
Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er
indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.
Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des
Artisten, ungeklärt.
Verlässliches über die Herkunft und den Werdegang Eduard / Edward
Klischnig(g)s war bisher kaum zu erfahren. Der Künstler soll am 12. Oktober
1813, nach anderen Angaben 1812, in London geboren worden sein und aus einer
eigentlich in Frankreich ansässigen Familie stammen. Doch Name und Herkunft
Klischniggs wurden wiederholt in Zweifel gezogen. So mutmaßte ein
Mitarbeiter der „Bohemia“ 1837, es könnte sich um das geraubte Kind eines
angesehenen Bankiers handeln, während ihn andere für den Sohn fahrender
Zirkusleute hielten. Klischnigg selbst hat wohl dazu beigetragen, seine
Herkunft zu verschleiern und einiges Anekdotenhafte über seinen Werdegang in
Umlauf zu bringen. So soll er als Siebenjähriger mit seinen Mitschülern ein
Theater besucht haben und von der dargebotenen Pantomime so beeindruckt
gewesen sein, dass er sie tags darauf nachahmte und durch ein Fenster ins
Klassenzimmer sprang. Nach einer unerfreulichen Begegnung mit seinem Lehrer
verließ er es angeblich auf demselben Weg wieder und entging seiner Strafe
durch die Übersiedlung der Familie nach Frankreich, wo er mit dem
artistischen Training begann. Nach England zurückgekehrt, soll er bis zum
14. Lebensjahr soliden Unterricht genossen haben, doch die Neigung zum
Theater überwog. Als angebliches Mitglied des Drury Lane Theatres übernahm
er zunächst komische Rollen, später die Partien des Clowns in
Weihnachtspantomimen. Nach anderen Angaben wiederum soll er seine
außerordentliche Gelenkigkeit während seiner Zeit als Matrose erworben
haben. Zur Rolle, in der er schließlich berühmt werden sollte – der des
Affen – fand er, als er für einen erkrankten Kollegen einsprang. Im
Affenkostüm trat er erfolgreich in London und Paris auf, soll, teils mit
einer eigenen Truppe, durch Frankreich getourt sein, Neapel und die
Niederlande besucht haben. Ab 1830 war er in Deutschland als „Joko, der
brasilianische Affe“ zu sehen. Auch von Gastspielen in Venedig und Mailand
wird berichtet. Sein Imitationstalent soll ihm sogar die Hand der Tochter
des “Tierbändigers” van Aken erworben haben: Als der Publikumsmagnet der van
Aken’schen Tierschau, ein Orang-Utan, schwer erkrankte und die Einnahmen
schwanden, ahmte Klischnigg das Tier derart gekonnt nach, dass er selbst van
Aken täuschte. Dieser willigte daraufhin in die Heirat ein. Auch das nur
eine Anekdote? Dem stehen jedenfalls Zeitungsnotizen entgegen, wonach
Klischnigg mit einem Fräulein Peschl oder Preschl, Choristin in Wien,
verheiratet gewesen sein soll.
Der „Kautschukmann“ Klischnigg
Von Klischniggs Darbietungen kann man sich heute nur
noch anhand von Zeitungsberichten und wenigen Druckgrafiken ein Bild machen.
1831 beispielsweise informierte die „Wiener Zeitschrift für Kunst,
Literatur, Theater und Mode“ ihre Leserschaft über Klischniggs Auftritt am
Königsstädtischen Theater in Berlin: „Er spreizt die Beine aus einander, daß
er vollkommen einem verkehrten lateinischen ┴ gleichend auf der Erde sitzt.
Er legt sich mit dem Körper bald auf das eine, bald auf das andere Bein,
legt dann die Beine auf den Rücken, und springt auf den Händen herum, er
stellt sich auf den Kopf, geht auf den Händen, und wirbelt die Beine wie
Windmühlenflügel, legt ein Bein auf den Rücken, und tanzt mit dem anderen
herum u. dgl. mehr. Diese Leistungen, obwohl nicht schön, sind doch sehr
merkwürdig.“ Spätere Berichte und Kritiken in verschiedenen Periodika
stimmen häufig darin überein, dass sich in Worten gar nicht schildern lasse,
was man mit eigenen Augen gesehen haben müsse. Speziell die Leichtigkeit und
Schnelligkeit seiner Bewegungen, „das sichtbare Abseyn aller Anstrengung und
Selbstqual“ und seine „federballmäßige légèreté“ frappierten die Zuseher.
Klischnigg als Affe Mamok in Nestroys Posse „Der Affe und der Bräutigam“
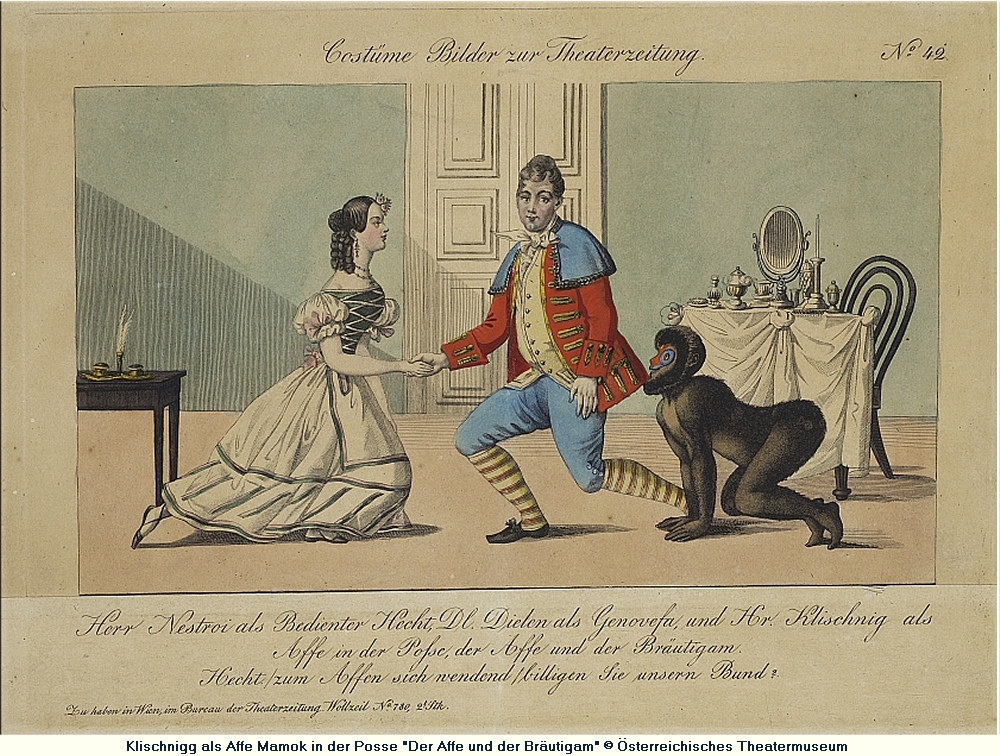
Der eigentliche
„Durchbruch“ als Affendarsteller gelang Klischnigg erst in Wien, wohin er
1836 gekommen war. Über seine Begegnung mit
Karl Carl, dem Direktor des Theaters an der Wien, kursieren verschiedene
Schilderungen. So soll Carl, als Klischnigg sich ihm als Affenspieler
vorstellte, knapp geantwortet haben, dass es in Wien bereits Affen genug
gebe. Der enttäuschte Klischnigg wandte sich zur Tür, um sich dann plötzlich
mit dem linken Bein hinter dem Ohr zu kratzen – womit er den Zweifler
überzeugte. In den „Innsbrucker Nachrichten“ hieß es über Klischnigg, „daß
er aus der Koulisse durch ein Fenster auf den Tisch sprang, an dem der
Direktor Platz genommen hatte, und sich dort wie ein Knäuel zusammenrollte.
Dann kletterte er an einer Koulisse empor, stürzte herab und spielte den
sterbenden Affen so naturgetreu, daß Carl sich sofort zum Abschlusse eines
Kontraktes bereit erklärte.“ Womöglich aber war es in Wirklichkeit der
Weitblick des Theaterunternehmers Carl selbst, der Klischnigg nach Wien
brachte.
In der Folge schrieb
Nestroy als Auftragswerk ein eigenes Stück für Klischnigg, in dem dieser
einen aus einer Menagerie entkommenen Affen darstellte. Die Komik der am 23.
Juli 1836 uraufgeführt Posse „Der Affe und der Bräutigam“ (auch „Affe und
Bräutigam“) speist sich aus fortlaufenden Verwechslungen zwischen dem
„echten“, von Klischnigg verkörperten Affen Mamok und einem als Affen
verkleideten Bräutigam, der beispielsweise die für Mamok bestimmten Prügel
bezieht, während Letzterer für den Gutsbesitzer gehalten wird. Das sehr
beliebte Stück kam zu Lebzeiten Nestroys 92-mal zur Aufführung, 49-mal
spielte Klischnigg den Mamok, während der Autor selbst in die Rolle des
Bedienten Carl Maria Tiburtius Hecht schlüpfte.
Klischnigg avancierte als
Mamok zum Publikumsliebling und konnte auch einen finanziellen Erfolg
verzeichnen. „Die Wiener wollen sich über seine Gelenkigkeit und seine
Sprünge fast todt lachen“, heißt es 1837 in „Europa, Chronik der gebildeten
Welt“. Ein weiteres für ihn geschriebenes Stück, die Zauberposse „Affe und
Frosch oder: Hudriwudris Zauberfluch“ von Franz Xaver Told und Georg Ott,
gab Klischnigg Gelegenheit, nicht nur als Affe (Muri), sondern auch als
Frosch (Buri) aufzutreten. Ein drittes Affenstück schließlich, die
Gelegenheitsposse „Der Mensch als Affe, oder: Der Affe als Mensch“ erzielte
keine vergleichbare Wirkung mehr. Die Theaterkritik würdigte zwar die
Leistung des hier ohne Maske auftretenden Klischniggs, empfand das Stück
aber insgesamt als abgeschmackt. Ende 1836 spielte Klischnigg dann auch an
anderen Wiener Bühnen, so in „La Peyrouse, oder der Affe von Malicolo“ am
Theater in der Josefstadt, wo er für die Faschingsburleske „Gig-Gig“ sein
Rollenfach auf Tiger und Schildkröte ausdehnte.
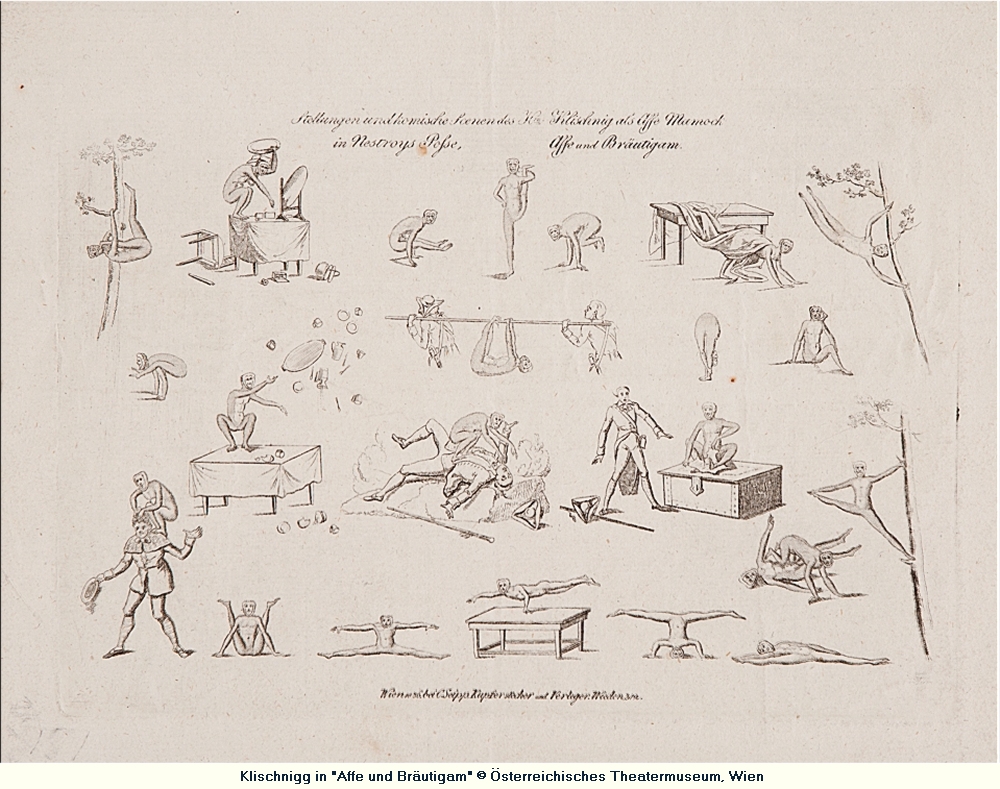
Klischniggs Gastspiele
Für ausverkaufte Häuser sorgte Klischnigg – auf
Theaterzetteln als „erster Mimiker der Theater zu Paris und London“ bzw. als
„erster Mimiker des Drurylane-Theaters in London“ angekündigt – auch während
seiner Gastspielreisen. 1837 kam er mit einer Olmützer Theatertruppe nach
Krakau und fand begeisterte Aufnahme. An der Theaterkasse waren Bilder mit
„komischen Szenen Herrn Klischniggs“ für sechs Groschen erhältlich. Pest,
Ofen und Prag bildeten weitere Stationen jenes Jahres. Obwohl die Prager
Theaterkritik derlei Produktionen für ein trauriges Zeichen der Zeit und
eines irregeleiteten Kunstgeschmacks hielt, wurde doch die Leistung
Klischniggs gewürdigt. „Desto entrückter war Alles, als endlich der ersehnte
Mamok auf allen Vieren erschien, auf einen Baum kletterte und in frei
schwebender Lage hoch oben die haarsträubendsten Affenkunststücke ausführte,
um die ihn verfolgenden Menagerie-Wächter zu täuschen“, berichtete Oskar
Teuber in seiner Theatergeschichte, und ergänzte: „Glücklicherweise war es
gerade im Carneval; dadurch wurde die Sünde am guten Geschmack zu einer
läßlichen.“
Nicht selten führten Klischniggs Auftritte dazu, dass
das Publikum „würdigeren“ Darstellungen fernblieb. So soll Klischnigg sich
in Hamburg regen Zulaufs erfreut haben, während die zur selben Zeit
gastierende Tragödin Sophie Schröder vor leerem Haus spielte.
Neben verschiedenen deutschen Städten waren unter
anderem Paris, Riga, Brünn, Olmütz, Agram, Krakau, Kronstadt und Pest Ziele
seiner Gastspielreisen. Immer wieder kehrte Klischnigg jedoch nach Wien
zurück, wo er etwa 1850 in „Der Orang Utang“ (Theater in der Leopoldstadt)
und im Spektakelstück „Der neue Robinson“ mit dem Vorspiel „Der
Frosch-Prophet“ (Theater in der Josefstadt) auftrat. Wiederholt war die
Arena in Hernals Schauplatz neuer Klischnigg-Rollen. Dort gab er 1852 das
Ungeheuer in der Zauberposse „Das Ungeheuer, oder: Herrn Blaumeier’s und
Frau Nanni’s Abenteuer in Pumzenstadl“ und 1853 den Clown in der
Zauberpantomime „Harlequin in der Blumenwelt“.
Eine späte Reprise von „Affe und Bräutigam“ 1857
„zeigte uns die 18 Jahre älter gewordene Posse und mit ihr den nicht jünger
gewordenen Herrn Klischnigg in selbsteigener Person“, schrieb der Kritiker
der „Presse“: „Man muß sagen, daß sich beide vortrefflich conservirt haben.“
Auch in „Jago, oder: Der Affe von Peru“ (Theater in der Josefstadt) war
Klischnigg 1864 „noch immer ein ganz tüchtiger Gymnastiker“. Am
Thalia-Theater spielte Klischnigg unter anderem in den Possen „Zambuko,
oder: Affe und Zigeuner“ (1861), „Albo, der Affe von Malicolo“ (1862) und
„Der Frosch im Stadtpark zu Kwang-Kiang-Fui“ (1863).
Ab 1866 hatte Klischnigg in seiner Tochter Eldora eine
Bühnenpartnerin. Sein „stark in Pathos arbeitendes blondes Töchterchen“
scheint allerdings ausschließlich in Schauspielrollen aufgetreten zu sein.
In schon fortgeschrittenem Alter gastierte Klischnigg dann Anfang 1873
nochmals am Theater in der Josefstadt in der Posse „Der Waldmensch in
Hütteldorf“, wobei er mit „einer Elastizität, die bei einem 65- bis
70jährigen Manne geradezu phänomenal genannt werden muß, Affen-Sprünge und
Gesten produzirte“, wie das „Neue Fremden-Blatt“ vermerkte. Zuletzt soll
Klischnigg 1875 am Carltheater in dem Ausstattungsstück „Die Reise um die
Erde in achtzig Tagen“ auf der Bühne gestanden haben.
Klischnigg starb am 17. März 1877 in der Wiener
Leopoldstadt und wurde auf dem Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf
beigesetzt.
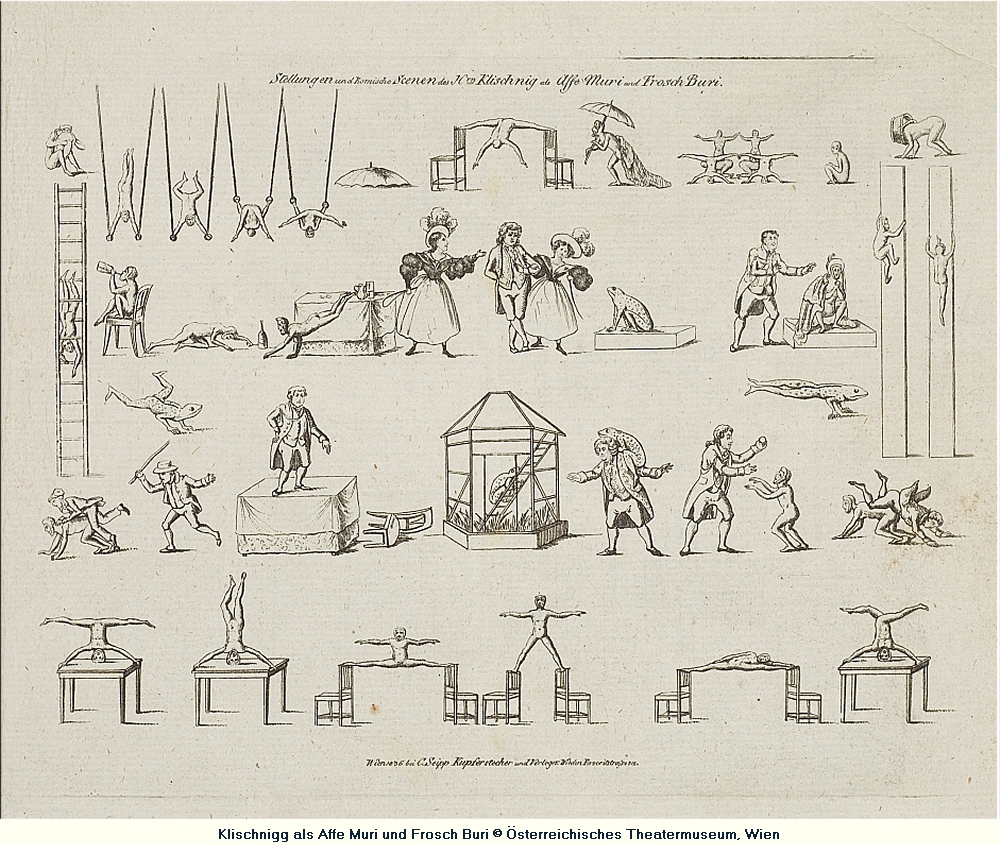
Klischniggs Ausstrahlungskraft
„Als Klischnigg zum ersten Male seine unsterblichen
Produktionen vorführte, konnte man monatelang nicht durch die Straßen Wiens
gehen, ohne Kinder in Dutzenden Klischnigg-Etudes einstudieren zu sehen“,
berichtete „Der Humorist“ 1840. Auch auf der Bühne produzierten sich bald
weitere Affendarsteller in Klischnigg’scher Manier. Viele haben ihm zwar
„das Gliederverrenken, das Beinverdrehen, das Gelenkauskegeln abgelauscht,
sie haben den Menschen Klischnigg
glücklich studiert und kopirt, aber die hohe Weihe und Vollendung,
mit der er in die Affen-Natur eingedrungen,
Klischnigg, der Affe bleibt
unerreicht für alle gegenwärtige, künftige Zeiten und Geschlechter!“ („Der
Humorist“, 1841). Noch 1850 reimte Nestroy in einer Coupletstrophe: „,Der
Klischnigg alleinʽ – so wird plauscht – ,Hat die Affennatur abgelauschtʽ“.
Auch Jahrzehnte nach seinem ersten Auftreten war
Klischniggs Name so geläufig, dass er im übertragenen Sinn für besondere
Wendigkeit oder, negativ besetzt, für Verrenkungen verschiedener Art
gebraucht wurde. So ist in Zeitungen von „Wort-Klischniggiaden“,
„publizistischen Klischniggs“ und „Klischnigglianern“ die Rede. Der
Pantomime
Karl Schadetzky wurde beispielsweise als „Klischnigg der Mimik“
bezeichnet, von einem Virtuosen hingegen habe man mehr zu erwarten als nur
einen „musikalischen Klischnigg“; sogar der Natur dichtete ein Journalist
die „gewaltigsten Klischnigg-Sprünge“ auf der Thermometerskala an.
Zur Bühnenfigur wurde Klischnigg erstmals 1871.
Anlässlich der Aufführung von „1001 Nacht im Theater an der Wien“ wurde das
Vorspiel „Papageno in der Theater-Kanzlei“ gegeben, zu dessen bunt
zusammengewürfelten Personen neben Wilhelm Tell, dem Alpenkönig oder der
Regimentstochter auch Klischnigg zählte. 2006 turnte dann neuerlich ein
Affendarsteller über eine Wiener Bühne: Peter Turrini ließ in seinem Stück
„Mein Nestroy“ einen „Affendarsteller aus Kärnten namens Klischnigg Karli
(mit Sprechverpflichtung)“ auftreten, dem er die bekannten Sätze eines
früheren Kärntner Landeshauptmannes „Bin schon wieder da“ und „Bin schon
wieder weg“ in den Mund legte.
Als Terminus technicus schließlich lebt Klischniggs
Name in der Artistensprache fort. In der Kontorsionistik bezeichnet die
sogenannte Klischniggerarbeit den Gegensatz zur Kautschukarbeit: Die „Klischnigger“
unter den Schlangenmenschen verbiegen ihren Körper hauptsächlich nach vorn,
während bei Kautschuk-Darbietungen der Körper nach hinten gebogen wird.
Schon 1864, also zu Lebzeiten Klischniggs, kündigte eine Zeitungsanzeige „Klischnigg-Arbeiten
des Herrn Simonelli“ anlässlich eines Kirchweihfestes an.
Literatur: Wiener Zeitschrift für Kunst ..., 24. 5. 1831;
Der Humorist, 21. 6. 1841; Der Zwischen-Akt, 14., 16. 11. 1858; Neues
Fremden-Blatt, 8. 1. 1873; Fremden-Blatt, Neue Freie Presse, 19. 3. 1877
(Abendausgabe), Innsbrucker Nachrichten, 23. 3. 1877; Tagesbote aus Mähren und
Schlesien, 22. 3. 1877; Neues Wiener Tagblatt, 10. 5. 1925; Czeike; Kosch,
Theater-Lexikon; Wurzbach; J. Tuvora, Aus dem Leben des Herrn Klischnig, in:
Allgemeine Theaterzeitung …, 29, 1836, S. 726f.; Rigaer Theater- und
Tonkünstler-Lexikon …, ed. M. Rudolph, 1890; E. Isolani, Ein berühmter
Affendarsteller, in: Bühne und Welt 2, 1. Halbjahr, 1900, S. 354–356 (mit Bild);
W. Binal, Deutschsprachiges Theater in Budapest, 1972, s. Reg.; J. Got, Das
österreichische Theater in Krakau im 18. und 19. Jahrhundert, 1984, s. Reg. (mit
Bild); J. Nestroy, Stücke 11, ed. J. Hein, 1998, S. 73–139, 245–340 (mit Bild);
J. Brabec, Une vie: Edward Klischnig (1813?–1877), in: Thesaurus circensis 1,
ed. G. Pretini, 1990, S. 73–84; P. Turrini, Mein Nestroy. Historische Dramen,
2008, S. 7–80; D. Krych, „Auch uns ist ein gut dressirter Affe lieber als ein
schlecht dressirter Komödiant“. Affentheater und Hundekomödien in Wien im 19.
Jahrhundert, in: Artistenleben auf vergessenen Wegen, ed. B. Peter – R.
Kaldy-Karo, 2013, S. 145–167; Evangelische Kirche in Wien, Kirchenamt A. B.,
Wiener Stadt- und Landesarchiv, Tagblattarchiv, alle Wien; Mitteilung Othmar
Barnert, Österreichisches Theatermuseum, Wien.
(Eva Offenthaler)
 „Ist
es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein
Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von
Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und
„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren
international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib
geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein
Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er
indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.
Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des
Artisten, ungeklärt.
„Ist
es ein Mensch? – Ist es ein Knäuel von Seide? – Ist es ein
Windmühlenflügel?“ Verblüffung erfasste einst die Zuseher beim Anblick von
Eduard Klischniggs akrobatischen Leistungen. Als „Tiermimiker“ und
„gymnastischer Künstler“ erregte Klischnigg in den 1830er-Jahren
international Aufsehen. Vor allem in der ihm von Nestroy auf den Leib
geschneiderten Posse „Der Affe und der Bräutigam“ begeisterte er sein
Publikum. An Klischnigg erinnert die diesmalige Biographie des Monats. Ob er
indes tatsächlich am 12. Oktober 1813 geboren wurde und damit seinen 200.
Geburtstag feiern würde, bleibt, wie die meisten Stationen im Leben des
Artisten, ungeklärt.