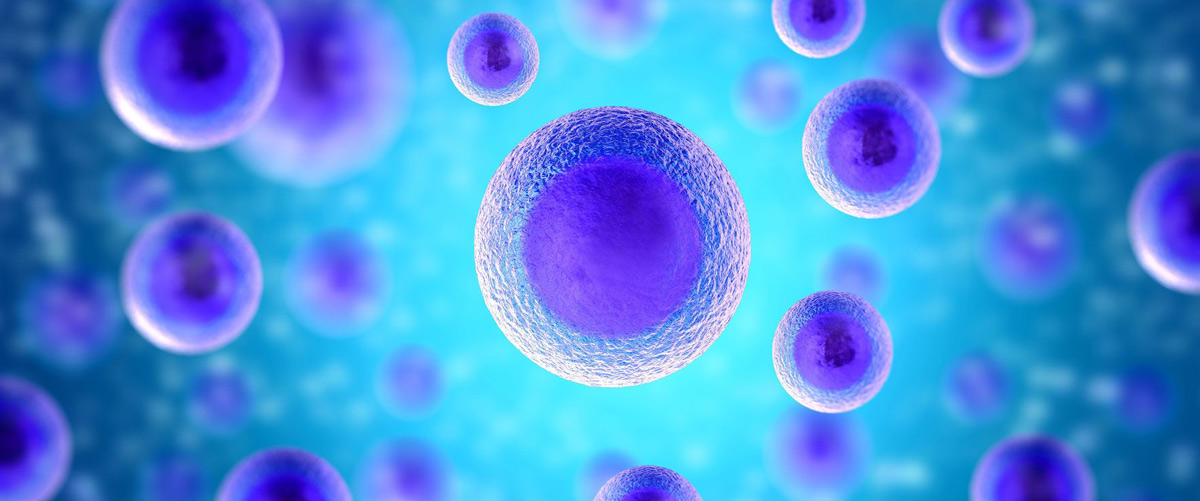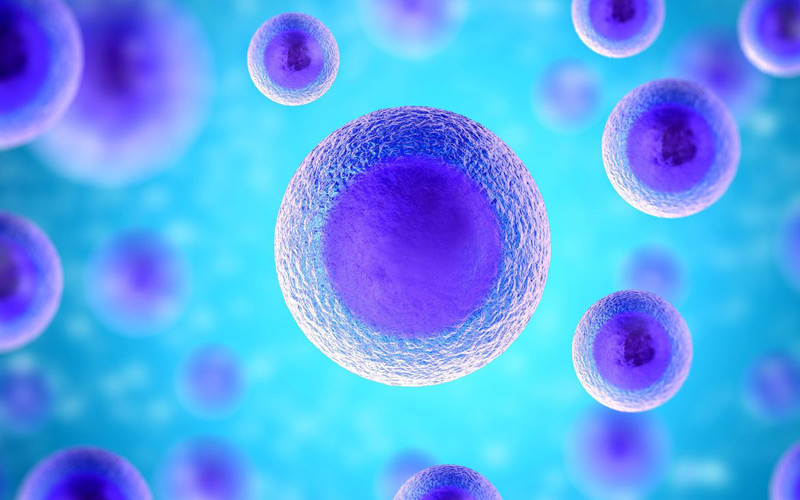„Forscher züchten Niere aus Stammzellen“, „Der geplatzte Traum von der Wundertherapie“, „Erfolgreiche Stammzelltherapie gegen Parkinson“, „Großbritannien erlaubt Gen-Eingriffe an Embryos“ – Stammzellforschung ist in den Schlagzeilen. Befürworter sind der Meinung, dass Stammzellforschung die Medizin der Zukunft revolutionieren wird, Kritiker halten diese Erwartung für übertrieben und äußern zahlreiche ethische Bedenken. Zwischen diesen beiden Extremen scheint wenig Platz zu sein.
Grund genug also, sich ein realistisches Bild von den Möglichkeiten und Grenzen der Stammzellforschung sowie ihren ethischen Implikationen zu machen. Eine Gelegenheit dazu bot die „Kardinal König – Walter Thirring Lecture“, die Naturwissenschaften und Religion ins Gespräch bringt und am 3. März 2016 erstmals an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) stattfand. Am Podium unter der Moderation von ÖAW-Präsident Anton Zeilinger: der Molekularbiologe Jürgen Knoblich, wirkliches Mitglied der ÖAW, und der Moraltheologe Stephan Ernst von der Universität Würzburg.
Hoffnungsträger Stammzellen
„Die Stammzellenforschung ist die große Hoffnung der Medizin, unheilbare Krankheiten heilbar zu machen“, betonte Jürgen Knoblich im Festsaal der Akademie und erklärte, warum diese Hoffnung nicht ganz unbegründet ist. Seit der Entdeckung der Stammzellen Anfang der 1960er Jahre habe es zahlreiche wissenschaftliche Fortschritte gegeben. Doch wovon ist eigentlich genau die Rede, wenn von Stammzellen gesprochen wird?
Ob im Blut, in der Haut, in der Muskulatur oder im Gehirn, in unserem Körper sterben täglich Zellen ab und werden durch neue wieder ersetzt. Diese Aufgabe erledigen sogenannte adulte, sprich „erwachsene“ Stammzellen. Sie sind nicht nur in der Lage, sich selbst zu erneuern, sondern bilden im jeweiligen Organ auch andere Zellen. So sorgen sie dafür, dass unsere Organe erhalten bleiben und funktionieren. Allerdings können Haut-Stammzellen nur Hautzellen produzieren und nicht etwa Blutzellen – dafür sind wiederum eigene Stammzellen im Knochenmark zuständig.
„Es handelt sich um ein Perpetuum mobile für ein zelluläres Ersatzteillager in unserem Körper“, so Knoblich, der als stellvertretender Direktor am ÖAW-Institut für molekulare Biotechnologie (IMBA) zu Stammzellen forscht. Das macht sie für die Medizin interessant. Denn man kann gesunde Stammzellen aus dem Körper entnehmen, im Labor vermehren und im Körper einpflanzen. Auf diese Weise wird zum Beispiel Blutkrebs erfolgreich behandelt: gesundes Knochenmark wird transplantiert und die Stammzellen tauschen die kranken Blutzellen im Körper gegen neue aus. Ganz so einfach sei es dann aber doch nicht, wie Knoblich erklärte: „Das Problem ist einerseits, dass sie sehr selten sind – es gibt nur einige Hundert davon in unserem Körper, wobei sie im Alter immer weniger werden. Darüber hinaus kann man sie nur schwer entnehmen.“
Alleskönner: embryonale Stammzellen
Stammzellen, die diese Probleme nicht haben, sind sogenannte embryonale Stammzellen. Jürgen Knoblich: „Sie sind ein kurzes Zwischenprodukt in der Entwicklung des Menschen und entstehen in der frühen Phase des Embryos, wenn dieser aus einem Ball von ca. 100 solcher Zellen besteht. Danach verschwinden sie wieder.“ Anders als erwachsene Stammzellen sind diese noch nicht ausdifferenziert, was bedeutet, dass sie jede Art von Körperzelle bilden können – egal ob Haut-, Muskel- oder Gehirnzelle.
Die Forschung damit ist jedoch ethisch äußerst umstritten – nicht nur, weil mit diesen Zellen das Klonen sowie die genetische Veränderung eines Embryos theoretisch möglich ist, sondern auch, weil die Embryonen bei der Zell-Gewinnung zerstört werden. Das führte in der Öffentlichkeit daher unweigerlich zu einer Debatte über den Beginn des menschlichen Lebens sowie zu der Frage, ob dadurch das Recht auf Leben verletzt wird.
Zudem sorgt die Beschaffung der Zellen für Diskussionen. Für gewöhnlich werden sie aus Embryonen entnommen, die ursprünglich für eine künstliche Befruchtung im Labor hergestellt wurden – auch In-vitro-Behandlung genannt – und schließlich übrig geblieben sind. Das wirft eine weitere ethische Frage auf: Darf man für Forschungszwecke absichtlich mehr Embryonen herstellen, als für die Behandlung tatsächlich notwendig?
Alternative mit Schönheitsfehler: iPS-Zellen
Seit 2007 gibt es für die Forschung jedoch eine Alternative: die induzierten pluripotenten Stammzellen – kurz iPS-Zellen. Damals fanden Forscher heraus, dass sich „normale“ erwachsene Körperzellen in ihren embryonalen Zustand zurück entwickeln lassen, das heißt, aus Hautzellen kann man quasi-embryonale Stammzellen herstellen.
Das ist ethisch weniger umstritten und hat auch den Vorteil, dass sie sich rasch von jeder Person aus der Haut oder dem Blut herstellen lassen. Zudem werden sie vom jeweiligen Immunsystem als eigene Zellen erkannt, da sie vom eigenen Körper und nicht von einem fremden Embryo stammen.
Also alles gelöst? Leider nein. Denn es gibt einen Schönheitsfehler: Auch wenn iPS-Zellen den embryonalen Stammzellen sehr ähnlich sind, zu 100 Prozent ident sind sie nicht. Aus diesem Grund werden nach wie vor beide Arten für klinische Studien eingesetzt – die ethische Diskussion und damit die Frage, wann menschliches Leben beginnt, ist also nicht vom Tisch.
Wo ist der Anfang?
Wie die Frage nach dem Anfang menschlichen Lebens zu beantworten ist, darüber gibt es keine Einigkeit – weder in Religion oder Philosophie, noch in der Naturwissenschaft. „Es ist jedoch keine Glaubensfrage und auch keine Frage der reinen Biologie“, schickte der Würzburger Moraltheologe Stephan Ernst seinen Ausführungen im Festsaal voraus. „Sondern wir müssen versuchen, diese Frage mit menschlicher Vernunft und anthropologischen Argumenten zu beantworten.“
Für manche liegt der Beginn in der Befruchtung der Eizelle, also wenn Samen und Eizelle verschmelzen. Denn bereits in diesem Moment sei eine neue Zelle entstanden, die genetisch individuell ist und die notwendigen Voraussetzungen für ihre Entwicklung erfüllt. Die Konsequenz dieser Sichtweise: „Demnach entwickelt sich der Embryo nicht zum Menschen, sondern von vornherein als Mensch“, so Stephan Ernst.
Gegen diese Vorstellung werde – auch innerhalb der theologischen Ethik – unter anderem argumentiert, „dass solange noch die Teilung des Embryos und somit eine Zwillingsbildung möglich ist, man noch nicht von einem Individuum sprechen kann.“ Das heißt, genetische Einzigartigkeit bedeutet noch nicht personelle Individualität.
Andere gehen noch einen Schritt weiter: Erst durch die Einpflanzung in die Gebärmutter sei eine wirkliche Entwicklung von embryonalen Stammzellen zu einem menschlichen Lebewesen möglich. „Der Zellhaufen“ alleine, könne nicht zum Menschen werden.
Für und Wider
Die Liste der Argumente ließe sich endlos fortsetzen und für jedes Argument scheint es ein Gegenargument zu geben, wie Ernst deutlich machte: „Man sieht, dass sich die Diskussion seit Jahren in dieser Frage festgefahren hat.“
Wie aber kann man mit dieser Unsicherheit ethisch umgehen? Geht es nach dem Moraltheologen, so liegt die Lösung im Prinzip der Verhältnismäßigkeit: „Das heißt, um ein erstrebenswertes Ziel zu erreichen, darf man nicht mehr Übel verursachen, als unbedingt erforderlich.“
Demzufolge wäre es denkbar, dass man jene Embryonen für die medizinische Forschung verwendet, die keine Aussicht auf eine Einpflanzung in einen Mutterleib haben – wie es im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation vorkommt. Die freigegebenen Embryonen könnten dann die Grundlage dafür sein, Menschen mit unheilbaren Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Querschnittslähmung eines Tages behandeln zu können.
In vielen Ländern, wie Australien, Japan, Indien, aber auch in Schweden, Spanien oder Großbritannien ist die Forschung unter diesen Voraussetzungen bereits erlaubt. Die britische Regierung hat nun sogar die Genmanipulation an Embryonen bis zum Alter von sieben Tagen zu Forschungszwecken genehmigt.
Und Österreich? Hierzulande ist es grundsätzlich verboten, embryonale Stammzellen für Forschungszwecke herzustellen und zu zerstören. Eine gesetzliche Grundlage, welche die Stammzellforschung klar regelt, gibt es aber auch nicht – was von vielen Seiten stark kritisiert wird. Die rechtliche Situation hat zur Folge, dass embryonale Stammzellen, ebenso wie in Deutschland, aus anderen Ländern importiert werden. Das wirft wohl erneut ethische Fragen auf.